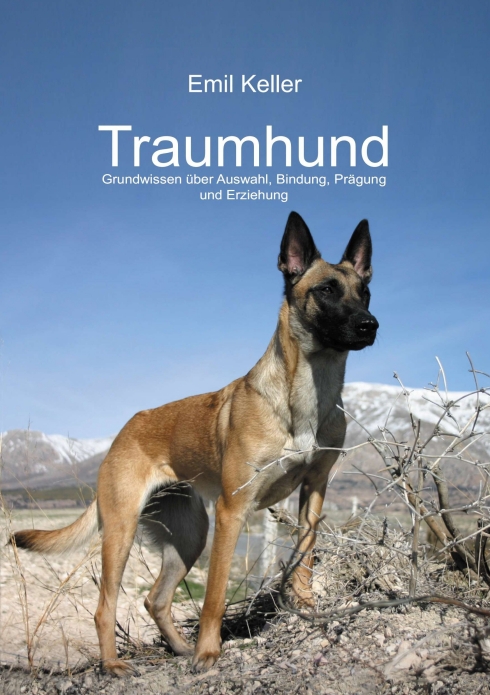Das Alleinlassen des Hundes muss gelehrt werden
Manche glauben, der Hund könne ohne Weiteres allein sein. Das ist nicht wahr, und er war es auch als Welpe bisher nie gewohnt. Er ist von Natur aus ein Rudeltier und will immer um uns sein. Er konnte sich bisher an Geschwister anschmiegen und nun sind wir für ihn verantwortlich. Also sind wir zu Beginn immer in Hör- und Sichtweite und setzen uns dazu, bis er einschläft. Man kann die Hundebox auch in der Nacht ganz am Anfang ins Schlafzimmer holen, und wenn der Hund unruhig wird, ihn umgehend hinaus tragen und auf den zum Versäubern bestimmten Platz bringen. Bei Erfolg wird er entsprechend gelobt. In der Nacht wird nicht gespielt, sondern man bringt ihn danach sofort wieder in seine Box. Schläft er nach einiger Zeit durch, können wir die Hundeschlafbox sukzessive aus unserem Schlafbereich entfernen, bis sie an der geplanten Stelle ist und bleibt. In Notfällen hören wir ja unseren Hund, denn man sollte immerzu in Hörweite sein, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist.
Wichtig ist die Konsequenz, mit der man ihm verbietet, sich in gewissen Räumen oder auf unseren Sessel/Diwan zu begeben. Ansonsten gehört eines Tages die gesamte Wohnung ihm, er verteilt den Dreck überall, denn der junge Hund hat die Angewohnheit, einem auf Schritt und Tritt zu folgen. So ist es auch wichtig, dass wir ihn zwischendurch in die Box legen, wenn wir in der Nähe sind, damit er sich daran gewöhnen kann. Er sollte uns dabei aber hören können. Wenn wir kurz hinausgehen, kann das Radio leise weiter laufen, was ihn beruhigt. Auf keinen Fall darf vergessen werden, ihm zu sagen: „Ich bin gleich wieder da“, auch wenn wir nur für fünf Sekunden weggehen. So lernt er, ohne den Zeitbegriff in Wirklichkeit zu kennen, „Ich bin gleich wieder da“ bedeutet für ihn, dass man sehr kurze Zeit weggeht und wiederkommt. Damit übt der Hund das Warten. Mit der Zeit werden die Abstände etwas größer, und es reicht ihm, uns nur zu hören, um ruhig zu bleiben, oder die Illusion des Radios gaukelt ihm vor, wir wären noch in der Wohnung. Eine kleine Belohnung nach der Rückkehr ist ebenso empfehlenswert und kostet fast nichts, lehrt ihn aber, auf die Belohnung zu warten, und das brave Ausharren wird so zum freudigen Erfolgserlebnis.
Schnell versteht und lernt der Hund, dass durch Fiepen oder Jammern seine Notdurft bekannt wird und er hinausdarf. Das macht er aus seiner Natur heraus, denn im Grunde verschmutzt kein gesunder Hund seine Schlafstätte.
Lasse ich ihn frei in der Wohnung laufen, kann bei Futterunverträglichkeit oder Krankheit Durchfall auftreten oder, wenn ich abgelenkt bin und den Hund nicht genügend beobachte, oder solange ich sein Verhalten noch nicht lesen kann, ein kleines Unglück passieren. Doch dann nützt nur das Bewahren von Ruhe. Grundsätzlich sind wir es, die seine Anzeichen übersehen haben, und sind selbst schuld. Den Hund niemals nachträglich über eine ihm längst nicht mehr bewusste Missetat beschimpfen, denn der freut sich ja, wenn wir zu ihm gehen, und wir würden das Vertrauen wieder zerstören, das sich gerade jetzt in einer wichtigen Aufbauphase befindet. Auf den Hund nicht achtend kann man, sofern man will, den Kothaufen oder den kleinen See während des Aufnehmens beschimpfen, aber niemals den Hund! Kommt man hinzu in dem Moment, wo es passiert, dann nimmt man den Hund wortlos und ohne Hektik auf, trägt ihn wort- und emotionslos auf das gewohnte Plätzchen, und schafft er es, sich weiter zu versäubern, so lobt man ihn ausgiebig! Danach wird das von ihm verunreinigte Örtchen aufgeputzt und möglichst desinfiziert. Dies nicht, weil wir nicht gut geputzt haben, sondern weil der Duft stets animiert, sich erneut an dieser Stelle zu versäubern. Eine Option ist auch das Entfernen der Teppiche in der Anfangszeit. So können wir billigste, rutschfeste Unterlagen, die leicht weggeworfen oder auch gewaschen werden können, benutzen, die einen guten Übergangsdienst erweisen.
Das Belohnen zu Beginn der ersten Zeit liegt vor allem im Verbalen und in Streicheleinheiten. Wir sollten möglichst wenig Leckerli gebrauchen (bestenfalls von seinem Welpenfutter), denn der Hund ist in dieser Phase mit uns selbst noch sehr zufrieden, und so schaffen wir das Grundvertrauen auf unsere ganz persönliche Art und Weise. Ein ständiges Belohnen mit Futter macht aus uns eine „Milchkuh“, und dies sind wir mit Sicherheit nicht. Ebenso sollte das Futter für spezielles Loben von der Tagesration stets abgezogen werden, sonst hat man allzu schnell einen dicken und gesundheitlich gefährdeten Hund.
Strafen
Korrekturen aufgrund zu konsequenter persönlicher Vorstellungen oder radikales Verhalten verängstigen den Welpen und blockieren sein Lernverhalten. Wir gewinnen dadurch keinen freudigen Freund, sondern einen Hund, der sich zu seinem Führer mit der Zeit passiv verhält, sich ängstigt und dadurch nicht mehr gut zuhört und schwieriger lernt. Dies heißt aber nicht, dass der Hund sich nicht gleichwohl später enorm interessiert zeigen kann an Beutespielen mit dem Ball. Das ist jedoch ein rein beutebezogenes Verhalten und hat mit Bindung überhaupt nichts zu tun.
Ein Hund mit Bindung ist lernbereiter, fröhlicher und akzeptiert auch ein „Nein“ ohne Problem, sofern wir ihm etwas anderes anfänglich dafür anbieten. Die Kunst des Hundeführers besteht nicht im Aberziehen, was der Hund nicht darf, sondern im Anerziehen, was er darf und tun soll.
Positive Erlebnisse und Spiele mit Gegenständen, die er ausreichend besitzen soll, machen, wie oben schon erwähnt, gleichzeitig anderes für den Welpen uninteressanter. Wichtig ist jedoch, dies dem Hund erst einmal „schmackhaft“ zu machen. Viele können sich nicht vorstellen, was sie mit einem so kleinen Hund alles unternehmen können. Ein Tipp: Ganz sachte beginnen, immer etwas bereitstellen und sei dies nur ein dickes Seil, Kartonschachteln oder ein Ball.
Frühkonsequenz heißt ganz einfach, den Hund durch Lob oder ein Futterstückchen so zu lenken, dass er macht, was wir wünschen. Alles bitte ohne Druck oder Ungeduld! Sitzt er nicht korrekt bei Fuß, so ermuntern wir ihn, dies zu verbessern und belohnen nur, wenn er unseren Wunsch korrekt erfüllt. Wir müssen lernen, nur bei richtigem Verhalten zu bestätigen, und was macht ein Welpe nicht alles für ein Stückchen Wurst oder einen kleinen, gewünschten Gegenstand? Kommandos wie „So ist‘s brav, Fuß, Sitz, Platz, Steh, Hier oder Komm“ lernt er so, sukzessive zu verstehen. Mehr braucht es nicht. Mit dem Befehl „Kehren (Wenden)“ während des Spaziergangs ergänzen wir liebevoll und freundlich. Viel mehr braucht der Welpe in der ersten Zeit nicht. Wichtig ist nur, Freundlichkeit, Verständnis, Schutz und Sicherheit zu bieten, um so den Welpen zu bestärken. Zu einer zuvor befohlenen „Stellung“ sollte man den Hund niemals handgreiflich zwingen. Führt er aber einen dieser Befehle aus, ohne dass wir ihn dazu geheißen haben, so bestätigen wir dies genauso mit „Brav Platz, Sitz“, indem wir zum Hund hingehen, uns zu ihm korrekt hinstellen und erst danach lobend sagen: „Brav, sitz“, oder „Platz“. So lernt er, wie wir es haben wollen und wie er belohnt werden wird. Frühkonsequenz heißt, bestimmt zu üben, mit so viel Einfühlungsvermögen und so wenig „Druck“ wie möglich, damit der Hund sich nie eingeschüchtert oder missverstanden fühlt.
Mit sechs bis sieben Monaten nimmt ein Hund eine seinem Alter entsprechende Korrektur ohne Angst oder Meiden (fliehen/zurückweichen) entgegen. Konsequentes Führen an der Leine oder allenfalls den Hund mit festem Griff in die richtige Position bringen, danach den Griff langsam lockern und sobald alles richtig ist, übergehen zu Streicheleinheiten und verbalem Bestätigen mit „So ist es brav“. So vollzieht sich der Wechsel von Frühkonsequenz zur Konsequenz, der bewirkt, und dies ist das Erstaunliche daran, die Erhaltung der bereits bestehenden Bindung. Setzen wir uns ab dem siebten Monaten nicht mit fester Hand durch, würde der Hund sein Vertrauen zu uns sukzessive verlieren und selbst die Führung „seines“ Rudels zu übernehmen versuchen. Daher ist es außerordentlich wichtig, uns wohlüberlegt stets durchzusetzen. Durch die dadurch erreichte wachsende Aufmerksamkeit des Hundes erfahren wir ein weiter ansteigendes positives Verhalten. Dieser Wandel ist sehr beglückend für das Team, jedoch führt der Weg nur über den Aufbau des Grundvertrauens, denn dies ist und bleibt die Basis.
Konrad Lorenz (1903–1989), österreichischer Verhaltensforscher und Nobelpreisträger (gefunden von P.M.-Leser Klemens Hartl, Österreich) machte folgendes Zitat:
„Wer einen Hund oder Affen, ja jedes höhere Säugetier wirklich genau kennt und trotzdem nicht davon überzeugt ist, dass diese Wesen Ähnliches erleben wie er selbst, ist seelisch abnorm. Er gehört in eine geschlossene psychiatrische Klinik, da seine Schwäche ihn zu einem gemeingefährlichen Wesen macht.“
Bindungsverlust zeigt sich dadurch, dass der Hund nicht erkennen kann, was er nun wirklich machen soll. Er ist durch das Verhalten des Hundeführers verunsichert und misstraut ihm. Im Grunde bräuchte der Hund nun Hilfe, doch wird dies nicht erkannt und man belastet ihn mit weiteren Korrekturen oder Befehlen, so belasten wir unsere Beziehung zu ihm erheblich. So bahnen sich Konfliktsituationen an, die als relevant angesehen werden müssen. Sollte sich dies weiter verschlechtern, kann es irgendwann zum Bruch des Vertrauens führen.
Wenn der Konflikt dazu führt, dass der Führer den Hund nicht mehr beherrscht und unbeherrscht straft, wird es schwierig, die zerbrochene Bindung wieder aufzubauen. Sollte der Druck des Führers so groß werden, dass sich der Hund verängstigt zu wehren beginnt, kann dies ein Zeichen sein, dass der Hund um sein Leben fürchtet. Der Halter glaubt sich durchsetzen zu müssen, wendet Gewalt an, was nie zum Ziel führt. Hier wäre ein Halterwechsel eine Option, um die Bindung zu einem neuen und erfahrenen Führer eventuell wieder herstellen zu können. Ein Hund ist hierzu in der Lage, sofern der neue Halter entsprechende Fähigkeiten und die notwendige Erfahrung mitbringt und der Hund nicht bereits zu stark geschädigt wurde.
Man könnte als weitere Option den Hund einige Monate „stehen lassen“, d. h. die Ausbildung ganz von vorne beginnen: beherrscht, sich in der Vorstellung seines Hundes als Kleinkind zurückversetzend, und liebevoll langsam erneut das Vertrauen des Hundes wieder erarbeitend. Andere Befehle benutzen, wie „Komm“ anstatt „Fuß“ oder „Assis“ für „Sitz“ und alles immer mit liebevoller Konsequenz. Dies könnte ohne Einschüchterung des Hundes und mit viel Geduld und Zuneigung zu einem neuen Bindungsverhalten führen. Garantien für eine neue Harmonie wird es kaum geben, doch befreien sich beide vom Druck, ist dies ein Versuch wert. Konsequenz bedeutet im Grunde nur klares und zielbewusstes Führen des Hundes, aber dies muss ohne Zwang und Strafe durchgesetzt werden.
Oft wird die Liebe zum Hund mit der Liebe des Hundes zum Führer verwechselt. Durch die Abhängigkeit des Hundes vom Besitzer glauben viele, eine „Bindung“ zu erkennen, doch dies ist sie nicht! Bindung muss man leben, um den Hund zu erleben. Nur die Leistungsaufforderung an den Hund und uneingeschränktes Vertrauen lässt dies erkennen, sofern er sich nie verängstigt zeigt und später auch bei lautem Tadel oder auch einem lauten „Nein!“ vertrauensvoll uns sucht.
Wie strafen wir ohne Bindungsverlust? Um es vorwegzunehmen: Beim Welpen/Junghund gibt es überhaupt keine Strafe. Wer konsequent das Gute lobt, braucht sich nicht zu ärgern, denn der Hund sucht automatisch das Lob. Was er nicht versteht, das bringen wir ihm ohne laute Worte oder gar Schläge bei. Was wir mitbringen müssen, sind Verständnis, Geduld, einfachstes Grundwissen und Einfühlungsvermögen, mehr nicht.
Verbeißt er sich in den teuren Teppich, so geht man hin, fasst den Welpen am Kragen und schubst ihn zurück. Wir selbst tun so, als beachten wir den Hund nicht, sagen weder Pfui noch sonst was, und tun, als wäre nichts geschehen. So lernt der Hund, was er darf und was nicht, und glaubt, die Bestrafung käme vom Teppichnagen. Dies jedoch nur solange, wie er uns noch nicht kennt oder eine mögliche Korrektur seines Handelns nicht voraussieht. Das Gleiche gilt bei Möbel oder anderen Gegenständen. Diese Art zu Strafen wenden wir nur zu Beginn an, beispielsweise in den ersten ein bis zwei Tagen, nachdem der Hund zu uns gekommen ist. In den meisten Fällen braucht es nur eine ganz kleine Korrektur (Schubser). Denken Sie daran; sobald der Hund unsere Absicht erkennt, korrigieren Sie nie mehr direkt. In dieser Situation unterbinden wir mit „Nein!“, und nimmt er Schuhe, strafen Sie den Schuh anstatt den Hund, und hier dürfen Sie aus sich herausgehen und gegen den Schuh treten, ihn auf den Boden schlagen und wettern, was das Zeug hält. Nach wenigen Malen lässt er auch diesen in Ruhe. Lassen Sie ihm die Freiheit in seinem Bereich, Sie können auch ganz teure Gegenstände für eins bis zwei Jahre wegräumen, aber bei guter Überwachung ist dies kaum notwendig. Der Hund lernt unglaublich schnell, sofern wir es vom Beginn weg richtig machen. Wehrt er sich gegen uns, wenn wir ihn irgendwo wegheben wollen, so fassen wir ihn mit fester Hand, beruhigen ihn und setzen ihn ohne weiteren Kommentar zu Boden. Wer sich vom Welpen in dieser Phase beeindruckt oder gar verängstigt zeigt, verliert wichtige Autorität. Wer sich an solchen Reaktionen sogar freut und meint: „Hast Du gesehen, was für ein wilder Teufel er ist?“, der wird in Kürze eine Korrektur machen müssen, und dies bedeutet eine unnötige, dumme und zusätzliche Belastung für Halter und Welpe, denn er wird ja immer stärker und wird es weiter versuchen. Hier gilt das Motto: Wehret den Anfängen! Ein Tipp aus Eric H. W. Aldingtons Buch „Von der Seele des Hundes“: „Zu Hause ist der Welpe mit Halsband/Brustgeschirr und Schleppleine zu versehen, um so stets einen indirekten Zugriff zum Welpen zu haben, ohne ihn handgreiflich korrigieren zu müssen. Der Welpe verknüpft den Leinenruck mit dem Objekt und nicht mit uns und schaut er uns nun verdutzt an, so rufen wir ihn und belohnen sein Kommen und nicht das Ablassen von einer unerwünschten Tätigkeit.“ Sollte es sein, dass der Hund den Schuh verteidigt und den Halter angreift, ändern Sie die Korrektur, respektive man verhindert das Knautschen am Schuh mit einem „Nein“, und legt den Schuh wieder an seinen Platz. Hält sich aber an die Kosequenz und versucht durch Ablenkung sein Interesse an den Schuhen zu eliminieren. Der Fantasie sind nie Grenzen gesetzt!
Strafen wir unbedacht, vielleicht mit einer Zeitung, kommt es vor, dass der Hund vor uns flieht. Hier hat uns das Tier nicht verstanden außer, dass wir für ihn mit der Zeitung eine Gefahr darstellen. Wir haben im Grunde nur erreicht, dass wir für ihn „bedrohlich“ sind und dadurch an Vertrauen einbüßen. Wenn wir hingegen erkennen, dass auf ein pures „Nein!“ unser Hund erstmal aufhorcht, er zu uns kommt und wir durch einen freudigen Zuruf oder Streicheleinheiten den Welpen bestätigen, haben wir gewonnen und ihn gelehrt, dass ein „Nein“ nicht nur Verlust, sondern auch etwas Angenehmes bedeutet. Immer, wenn wir den Hund beim Namen rufen und er dann kommt, belohnen wir ihn mit Freude! Rufen wir und er reagiert nicht sogleich, so korrigieren wir innerhalb der nächsten drei Sekunden. Dies sollte man nie in ärgerlicher Stimmung machen, sondern emotionslos. Zeigen Sie sich im Nachhinein beleidigt oder strafen Sie später, kann er dies weder ein-, noch zuordnen und wir belasten damit nur unnötig sein Vertrauen zu uns.
Wir müssen lernen, die natürlichen Instinkte zu kanalisieren. Benimmt er sich nicht richtig, beginnt er am Tischtuch zu ziehen, so versuchen wir durch ein scharfes „Nein“ sein Tun zu stoppen. Reicht dies nicht aus, rufen wir den Hund durch eine andere Motivation weg und präparieren danach den Tisch. Zieht er abermals am Tischtuch, fallen neben ihn ein paar leere, leichte Büchsen, Pfannendeckel oder sonst was zu Boden, damit es so richtig scheppert und er sich erschreckt. Dies wirkt in fast allen Fällen als heilsame Erfahrung. Das sind ganz einfache Mittel, und doch sind diese besser als jeder persönliche EINGRIFF für das Vertrauensverhältnis zwischen Halter und Hund. Es handelt sich um sogenannte praktische Erfahrungen des Hundes, die er verstehen und verarbeiten vermag und die er nicht mit seinem Halter in Verbindung bringt.
Zuviel und zu früh perfektionieren, zu große Belastungen durch ungeduldige Kommandos für „Sitz, Platz“ oder „Fuß“ zerstören ebenso sein Vertrauen zu uns. Wer Geduld und Distanz zur Aufgabe hat, sich Zeit nimmt, über Probleme zu reflektieren, kann durch freudvolles Führen und durch Lob fast alles erreichen. Es ist belanglos, ob wir zu Beginn schneller oder langsamer vorankommen. Wichtig ist, dass wir mit Freude über das Spiel – im wahrsten Sinne des Wortes – zu motivieren versuchen. Der Hund wird damit freier, fröhlicher, aufmerksamer und zudem umgänglicher. Sozial verträgliche Hunde sind in der heutigen Gesellschaft wünschenswert, sind Balsam für die Seele, schaffen spannenden Ausgleich, machen Spaß und bringen Gesundheit. Viele Hunde lechzen nach Betätigung und noch mehr Bestätigung, also geben wir ihnen dies durch Lob und Freude, denn so entsteht eine Balance aus Geben und Nehmen. Wer dies erreicht, ist großartig! So wird schlussendlich die ganze Erziehung zu einem permanenten zielgerichteten Spiel. Bis wir diese Kunst beherrschen, braucht es allerdings etwas Übung und den Einsatz unserer Fantasie. Erziehung respektive Dressur über Strafe ist oftmals nur der Beweis der Hilflosigkeit des Menschen gegenüber dem Tier!
Opfern wir ein paar Kartonschachteln während der Welpen- und Jugendzeit des Hundes. Dies ist für den Tätigkeitsdrang des Hundes ein tolles Ventil. Ärgern wir uns nicht über die herumliegenden Kartonschnipsel! Entreißen wir ihm niemals einen eroberten Gegenstand, sonst bringt er uns nichts mehr. So funktioniert Erziehung. Überlassen wir ihm auch immer genügend Spielsachen, um sich selbst zu beschäftigen. Das ist es, was er zusätzlich braucht, um überschüssige Energie ablassen zu können. Werden wir großzügig und tauschen – denken wir daran, ein Stück Karton kann für den Hund mehr Wert sein als die Fernbedienung unseres Fernsehers!
Ein zu früh und ungelernt alleingelassener Hund, oder ein Hund, den man in Abwesenheit in ein Zimmer sperrt, also nicht mehr in der normalen täglichen Umgebung belässt, kann durch die Einengung und die damit entstehende Erregung zum „Terroristen“ verkommen. Er wird Möbel, Kissen und anderes annagen, zerreißen; kurz und gut, je nach seinem Charakter mehr oder weniger zerstörerisch auf die Situation reagieren. Ein Hund muss alles erst lernen, oder wir lehren ihn, im Zwinger zu leben. Wie lange dieser Lernprozess zu Hause dauert, ist individuell verschieden und nie genau vorhersehbar. Abgesehen davon entwickelt sich ein weggesperrter Hund ohne viel Abwechslung nicht so vielseitig wie ein Hund im menschlichen „Rudel“ mit viel Abwechslung und Sozialkontakten. Es kann bis zu einem Jahr dauern, bis man ihn allein und ohne Einschränkung zu Hause lassen kann. Strafen wir nie, wenn wir nach Hause kommen und der Hund mitten im Chaos schläft, denn wir sind selbst schuld, denn wir haben den Hund nicht korrekt auf diese Situation vorbereitet, respektive er hat es noch nicht verstanden beziehungsweise lernen können!
Ein konsequentes Durchsetzen einer Übung ist erst ab sechs bis sieben Monaten wichtig, tun wir dies dann allerdings nicht, geht der bisherige Lerneffekt des Hundes sukzessive dahin, das heißt, er lernt das Ausweichen, das Verhindern und nimmt dieses Verhaltensmuster in die weiteren Erziehungsphasen mit. Später sucht jeder Hund aus natürlichem Instinkt unsere Schwächen und nutzt sie aus, wenn wir dies nicht frühzeitig erkennen lernen. Hundeausbildung ohne vollstes Engagement im Verstandesbereich ist vergebene Liebesmühe. Dies betrifft unsere Einstellung zum Hund, indem wir ihm im Spiel zu zeigen versuchen, wie oder was wir gerne zu erreichen wünschten, um dies für den Hund verständlich zu machen. Durch Bestrafung kann der Hund nicht lernen. Negative Emotionen belasten das Vertrauen zu uns, verunsichern und verhindern positives Lernen. Strafen aus einer Emotion heraus (Wut, schlechte Laune) beschädigt, verunsichert und verhindert die Kommunikations- und die Lernfähigkeit!
Erste Spaziergänge im Alltag
Selbst das Führen eines Hundes die Straße entlang muss gelernt sein. So nehmen wir die kurze Leine, halten diese aber stets lose, damit der Hund ausweichen kann. Man führe ihn von Anbeginn an immer links. Sollten Geräusche von Autos usw. ihn ängstigen, lässt man die Leine so lang, dass er nicht angefahren werden kann, eben so lang, dass er selbst in eine für ihn sichere Zone ausweichen kann und darf. So lernt er, dass ihm nichts passiert, und wir gehen mit ihm weiter, ihn aufmunternd und weiterhin links führend. Wir sind der Leithund und jederzeit den Situationen gewachsen. Diese Ausstrahlung bemerkt der Hund, denn wir spielen so auch verhaltensmäßig den Rudelführer, der an die für den Welpen noch neuen Erlebnisse ja gewohnt ist. Wir überfordern den kleinen Welpen nie und führen ihn richtig – mit Vernunft und Verstand.
Nie lassen wir den kleinen Wicht in die Leine beißen oder damit spielen. Die Leine ist für die Zähne ein absolutes Tabu. Wer diese Regel nicht beachtet, riskiert, dass der Hund später, wenn er irgendwo daran angebunden werden muss, sie versucht zu durchbeißen und sich aufmacht, uns zu suchen. Wir können zur Abwechslung auch mal auf einem Feldweg oder auch quer durch den Wald spazieren, den Welpen frei laufen lassen und sehen, wie er sich trotz der gewonnen Freiheit bemüht, uns zu folgen. Dies entspricht dem Urinstinkt, denn verlöre er den Anschluss an uns, weiß er instinktiv, dass er verloren ist.
Doch zurück zu unserem Spaziergang. Auf der nächsten größeren Wiese angekommen, wechseln wir die Leine und nehmen die lange, dünne und leichte. Wir lassen unseren Welpen sich weiter entfernen und versuchen ihn mit dem Ruf: „Hier“ zurückzurufen. Man kann auch leicht auf den Boden klopfen oder sich selbst klein machen, um für den Welpen attraktiver zu sein. Alles, was die Aufmerksamkeit fördert und Vertrauen schafft, ist hier wichtig. Kommt er, so freuen wir uns offensichtlich und zeigen uns begeistert. Danach lassen wir ihn wieder springen und üben dies einige Male. Unsere Freude, unsere freudige Stimme wird unseren Schützling motivieren. Kommt er nicht, so zupfen wir ganz zart an der Leine, wiederholen das „Hier“ und wenn er wieder da ist, dann zeigen wir unsere Freude erneut und belohnen genauso wie das erste Mal. In drei bis vier Wochen können wir schon versuchen, die Leine loszulassen, und meist klappt es dann genauso. Man hüte sich aber vor dem Überfordern! Eine Übung nur dreimal wiederholen und dann erst wieder beim nächsten Spaziergang. Die sogenannte lange „Schleppleine“ belassen wir, solange dies nötig ist. Wir bremsen den Hund durch die Leine nur, wenn zuvor ein Kommando gegeben wurde. Mit der Zeit kann die Leine verkürzt werden. Der Hund merkt dies nicht und wird trotzdem gehorchen.
Warum „Hier“ und nicht „Rex, hier“? Der Rufname des Hundes soll zu Beginn nur in positivem Zusammenhang verwendet werden. Mit ihm verbinden wir ausschließlich Freude und Lob. Kommandos können später mit mehr Nachdruck gesprochen werden. Der Rufname soll vertrauen erhaltend wirken. So prägt sich sein Name positiv in sein Leben, und der Hund kommt stets gerne und freudig zum Hundeführer, denn sein Name bedeutet für ihn ja Schutz, Lob und Freude. Selbstverständlich soll auch das „Hier“ ebenso freundlich gerufen werden wie der Name. Die Konsequenz unseres Befehls liegt jedoch auf einer anderen Ebene als der Rufname und muss später (ab 6–7 Monaten) stets durchgesetzt werden. Beim Welpen braucht es aber noch einige Zeit, bis er alles so richtig versteht, und daher ist Geduld gefragt. Wenn ich meinen kleinen Welpen an der langen Leine habe, und „Hier“ sage, so lasse ich ihn einfach nicht los und bemühe mich, ihn mit allen Tricks zu mir heranzulocken, sodass ich mich auf diese Art und Weise durchsetze. Ich kann auch ganz leicht an der Leine zupfen, um im Welpen ein leichtes, unangenehmes Empfinden zu wecken. Aber niemals einen persönlichen Druck ausüben, wie schnellen Schrittes holen und packen oder nachrennen. Man kann auf freiem Feld auch einfach in die entgegengesetzte Richtung „zum Schein flüchten“ und er wird mit Sicherheit heranbrausen.
Einen Welpen ausführen ist oftmals wie Kino. Beobachtend erkennen wir seine Ängste, sein Zögern, seine Neugierde, seine Unsicherheit, Frechheit und seine Lust am Kennenlernen seiner zunächst unmittelbaren Umgebung. Alles ist neu für ihn, und zu Beginn braucht er unsere Unterstützung, um ein gewisses Unbehagen, das von für uns nicht speziellen Vorkommnissen herrührt, in Erfahrung umzusetzen. Wir sind der „Leithund“ und haben eine wichtige Lenkungsfunktion als Oberhaupt des kleinen Rudels. Wir sollten uns nicht ärgern, wenn unser Hund sich auch einem kleineren Hund gegenüber auf den Boden legt. Wir sollten uns darüber freuen, dass er so schlau ist, sich nicht in einen Kampf einzulassen. Das Spielenlassen mit Hunden, die man auf seinen Spaziergängen trifft, sollte man zu Beginn auf jeden Fall nicht zulassen, denn wie schnell wird ein Welpe durch einen beißwütigen Hund verletzt und nimmt durch den erlittenen Schock selbst seelisch Schaden.
Zeigt er Angst vor einer Mülltonne, dann lassen wir ihn an langer Leine etwas zurück und gehen selbst zur Mülltonne, dem Hydranten, dem Baumstrunk oder was ihn auch immer verunsichert. Wir betasten dieses „Mysterium“, klopfen mit den Schuhen daran und demonstrieren unserem kleinen Begleiter, dass hier nichts Bedrohliches ist. Mit der Zeit wird er näher kommen, vorsichtig und zögerlich schnuppern, und schon nach kurzer Zeit ist er beruhigt und geht weiter. So lernt unser Hund seine Umgebung kennen und fühlt sich sicher und wird gleichzeitig selbstbewusster. Nichts ist schlimmer, als ihn in eine für ihn bedrohliche Situation zu zwingen oder daran vorbeizerren zu wollen. Geben Sie ihm Zeit, alles in Ruhe kennenzulernen, versetzen Sie sich in sein kurzes Leben und erfahren Sie, wie enorm lernfähig unsere kleinen Wichte in Wirklichkeit sind. Freuen Sie sich an allem, was er schon kann. Bedenken Sie, wie viel Neues er in kürzester Zeit verarbeiten muss. So wächst auch unser Vertrauen zum Welpen, denn wir sind für ihn ja das große Vorbild und, wie schon gesagt, der Leithund oder Elternersatz.
Lassen Sie den Hund nicht mit größeren und schwereren Hunden spielen, seine Knochen und Gelenke sind noch zu weich und sein Körper braucht noch Schonung. Spielstunden für Welpen bieten den enorm wichtigen Umgang mit anderen Hunden. Nutzen Sie dieses Angebot so ausgiebig wie möglich. Kurse bieten unserem Schützling viel an Erfahrung, was für sein späteres Leben sehr wichtig ist. Kein Kurs ist gleich aufgebaut, und in jedem wird differenziert gelernt. Erst wenn seine Persönlichkeit genügend gewachsen ist, lassen wir ihn zwischendurch mit größeren Hunden spielen, sofern diese genügend sozialisiert sind und durch Größe und Gewicht bei unserem Hund weder einen körperlichen noch seelischen Schaden mehr anrichten können. Beobachten wir aber unseren Hund genau, und wenn er Angst zeigt, (z. B. seine Rute einklemmt) brechen sie das Spiel sogleich ab. Vereinbaren sie dies auch mit dem anderen Hundehalter.
Wenn wir das Jagen nach Katzen, Füchsen, Rehen, Schafen oder Wild verhindern wollen, so unterbinden grundsätzlich wir jeden Versuch, irgendeinem Lebewesen, sei es auch nur einem Schmetterling, einem Blatt im Winde oder einem Vogel nachzurennen, indem wir unseren Schützling, der sowieso noch an der Leine ist, sofort zurückrufen. Gehen Sie absichtlich an Katzen, Hühnern, Schafen, Enten oder Tauben vorbei, und beobachten Sie ihren Welpen. Bei der geringsten Neigung zum Hingehen sagen wir ruhig „Nein“ und machen eine Kehrtwendung. Folgt uns der Hund, belohnen wir. Auf einem Waldspaziergang begegnen wir Reitern, Joggern, Fußgängern, Radfahrern und je nach der Wegbeschaffenheit noch anderen Fortbewegungsmitteln. Was auch immer kommt, der Welpe ist bei uns oder wir rufen ihn zu uns. Unser Ziel ist, seine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, indem wir ein Spielzeug oder Leckerli benutzen, ihn damit locken, ablenken und belohnen. Will er z. B. zu einem Hund und halten Sie die Leine straff, denn der Schmerz durch das Zurückreißen des Hundes bezieht er auf das, was er anschaut, und er interpretiert den Ruck als vom anderen Hund ausgehend. Dies führt nur zu erhöhter Aggression. Auch hier gilt es, ihn freundlich zu sich zu rufen, und anschließend die damit erweckte Erwartung auf Streicheleinheiten oder Belohnung zu bestätigen.
Die Kontrolle über den Welpen durch die Führ-Leine ist gerade in diesem Stadium sehr wichtig, denn so sind wir in Verbindung und leben die Kommunikation zu unserem Hündchen. Machen Sie sich zum Kumpel ihres Hundes, spielen sie viel mit ihm, denn ihr Verhältnis und ihr heutiger Einsatz zahlen sich aus. An der Leine gibt es keine Zwänge für den Jung-Hund, sie ist lediglich die Verbindung. Blockieren sie nur und versuchen sie den Hund zu sich zu locken, reißen sie nicht zurück, sondern motivieren sie ihn zurückzukommen. Nutzen sie diese Gelegenheit, denn am Ende ist dies der Schlüssel zur Leinenführung.
Wir können auch das „Steh“ und „Warten“ üben, wenn wir eine Straße überqueren wollen und anhalten müssen, bis sich der Verkehr gelegt hat. So lernen wir nützliche Notkommandos auch für später.
Betrachten wir uns auch als Vorbilder für unsere Gesellschaft. Gute Hundeführer nehmen den Kot immer auf, außer im Waldesinnern. Nichts ist ärgerlicher für Spaziergänger, als an Wegrändern Blumen zu betrachten und dabei Häufchen der Ausscheidungen unserer Hunde sehen und riechen zu müssen. Das Aufnehmen und Entsorgen wird durch die Gemeinden stark gefördert mit „Robidogs“, und zudem tun wir das ja für den eigenen Hund meist ohne Ekelgefühl. Wir respektieren damit auch das Kulturland der Landwirtschaft. Nur wenige machen sich bewusst, dass Nutztiere verunreinigtes Gras nicht mehr fressen. Selbst für uns ist das Aufsammeln von großer Wichtigkeit, denn oft informiert uns die Ausscheidung über den Gesundheitszustand. Sind wir gezwungen, den Hund jemandem zum Versäubern anzuvertrauen, legen sie ihm diese Bitte ans Herz. Er wird sich mit dem notwendigen Respekt zur Umwelt überwinden, obwohl stets ein gewisser Widerwille bei einem nicht sehr nahestehenden Tier naturgemäß da ist.
Gedankenlose waschen Ihre Hunde in öffentlichen Brunnen oder kühlen diese im Sommer darin ab. Hiermit vermiesen Hundebesitzer vielen Menschen eine willkommene Möglichkeit, sich erfrischen zu können. Kindern verderben wir das Planschen und verteilen zudem unter Hunden Erreger von verschiedensten Erkrankungen. So verkommt der Nutzen dieses Geschenkes an die Mitbürger zum Ärgernis und Widerstand gegen die Hundehalter entsteht. Praktisch alle Brunnen verfügen über eine Hundetränke. Diese ist klein und nur für den Vierbeiner bestimmt. Auch in Stadtnähe haben Landwirte große Brunnen, aus denen Kühe trinken. Trotzdem gibt es unbedachte Hundebesitzer, die nicht nur ihre Hunde aus diesen Brunnen trinken lassen, sondern auch noch ihre Hunde darin baden. Dass dies absolut unangebracht ist, sollte klar sein.
Zuhause und Allerlei
Waren wir draußen, ist der Welpe versäubert, können wir auch zwischendurch im Haus ein Spiel eröffnen. Wir sollten wie schon gesagt Pappschachteln zum Zerreißen anbieten, wir können einen Ball davon kullern lassen, und wenn er ihn fängt, ihm zurufen, er möge ihn bringen (aber nur lobend und nie aus dem Fang nehmen, außer man tausche mit etwas anderem!), wir können beobachten, was er alles sieht und auskundschaftet und darauf eingehen. So haben wir tausend Möglichkeiten, uns mit ihm zu beschäftigen. Wichtig ist, dass er gerne etwas tut, und zwar, dass er nur das tut oder zerfetzt, was wir für ihn bereitstellen. Wir können, wenn er sich setzt, „Sitz“ und „Brav Sitz“ sagen und ihn mit Lob und Streicheleinheiten belohnen, sodass er dieses Wort als harmonisches Kommando kennenlernt, das gleiche geht auch mit „Platz“ „Platz bleib“ oder „Steh“, wenn wir ihn streicheln. Auch das Wegnehmen eines Gegenstandes, den er bringt, sollten wir unterlassen, denn eines Tages bringt er den nicht mehr, weil er die Erfahrung machte, diesen an uns zu verlieren. Wenn schon, dann nur tauschen gegen ein Häppchen oder noch besser gegen ein anderes Spielzeug. Besser ist es, ihn durch Streicheln zu loben, was er da uns gebracht hat, ohne es zu berühren und wegzunehmen. So lernt er tragen, und wenn wir ihm unseren Stolz vermitteln können, hat auch er seine Freude. Später können wir leicht am Gegenstand zupfen, den Anschein geben, als wollten wir ihn stehlen. Wenn er nun obsiegt, wird sein Selbstbewusstsein wachsen und wir sehen, mit welchem Stolz er das weiterhin in seinem Fang behält. Es gibt noch Dutzende von Spiel-Arten und Unterhaltung die wir mit dem Welpen machen können, etwas verstecken und schauen, ob er es findet. Wir brauchen einfach etwas Fantasie, und schon klappt es nach einigen Versuchen. Sein Suchinstinkt kann so zu Hause trainiert werden, wie vieles mehr.
Wenn wir den Hund streicheln und mit ihm reden, denken wir nie, dass wir etwas falsch machen könnten, und doch kann dies unter Umständen nachhaltig negative Folgen nach sich ziehen. Wenn wir ihn streicheln, um ihm Angst zu nehmen (er wurde z. B. durch einen anderen Hund gepackt, durch uns oder andere unachtsam getreten, weil es blitzt und donnert usw.), so wirkt das Streicheln des Hundes in dieser Situation als Angst- und Jammerverstärker und ist absolut zu vermeiden. Demonstrieren Sie, dass Blitz und Donner oder Feuerwerk überhaupt nicht beeindrucken, indem Sie Gelassenheit ausstrahlen; streicheln Sie nie in Schreckphasen oder Unsicherheit, denn persönliche Angst des Hundeführers überträgt sich auf den Hund. Wenn etwas passiert, ist es wichtig, zuerst eine gewisse Distanz zu schaffen, gut zu beobachten, unter Umständen vorerst im Spiel weiterzumachen als Ablenkungseffekt, und nur bei einer wirklichen Verletzung den Hund berühren, um ihn zu untersuchen. Oft verlangt dies eine gewisse Selbstüberwindung. Wenn wir den Hund nach einiger Zeit erst untersuchen und ihn abtasten, um zu sehen, ob wirklich keine oder allenfalls welche Verletzung vorliegt, so ist dies meist mehr als genügend. Bei starkem Blutverlust selbstverständlich sofort zum Tierarzt, ansonsten umsorgen wir den Hund nie zu expressiv, sondern nur zweckmäßig mit Betonung auf eher abwartend und zurückhaltend. Es könnte sehr wohl sein, dass der Hund bei emotionalem Verhalten uns später durch Simulieren oder durch anerzogene Angstzustände ganz schön auf Trab hält. Mein Donar verletzte sich leicht an einer Eisentreppe, weil sich sein Bein zwischen den Tritten unglücklich verklemmte. Als ich dies sah, habe ich ihn sogleich untersucht, armer Donar gesagt, ihn gestreichelt und langsam ging es wieder besser. Nach 3 Monaten erinnerte er sich an die Geschichte, hob erneut sein Bein hoch und winselte, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Als ich das sah, sagte ich: „Simulant, hör auf damit!“ Er stellte sein Bein ab und von dann an war diese Geschichte vergessen. So bringen uns Engagement und Einfühlungsvermögen dem Verständnis, „was es ausmacht“, täglich näher. Haben wir den Hund getreten, weil er uns im Weg lag, lernt er hiermit automatisch, sich nicht mehr dort hinzulegen. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn wie schnell kann man in den eigenen vier Wänden unglücklich über den eigenen Hund stürzen. Aus dem Weg gehen bedeutet gesundes Rudelverhalten, denn auch im Rudel gehen die Rangniederen dem Leitwolf aus dem Weg. Wer dies frühzeitig anerzieht, hat viele Vorteile und bestätigt seine Rolle als Rudelführer und wirkt überdies als aktiver Selbstschutz. Eine interessante Feststellung machte ich, als ich einmal einen Hund zu mir nahm, der stark unter der Schussangst litt; auch Donner und Feuerwerk waren für ihn so traumatisch, dass auch ein gesunder und unbeeindruckter Hund ebenfalls diese Angst in leichter Form übernahm. Auch daraus lernen wir, dass jeder seinen Hund selbst macht und für vieles vorsorgen muss.
In der Box, wenn er fiept oder bellt, obwohl Sie kurz zuvor draußen gewesen waren, der Hund versäubert ist und er einfach nur wieder hinaus möchte, nehmen Sie den Hund nicht aus der Box, solange er bellt! Immer erst, wenn er ruhig ist, denn er könnte ja verknüpfen: Wenn ich nur genug belle, dann holt man mich heraus. Hiermit versucht der Welpe, sich bereits gegenüber uns durchzusetzen, was nicht sein darf.
Verletzt er uns beim Spiel, dürfen wir ruhig „Au!“ rufen, aber nicht so, dass er zu Tode erschrickt, ihm aber trotzdem gezeigt wird, dass es uns wehgetan hat. Wird er allzu grob, brechen wir das Spiel ab. So lernt er, dass wir nicht mehr spielen, wenn es zu grob wird. Bitte weder zurückschlagen noch zurückbeißen oder erschrecken durch Urschreie, nein, alles mit einem Lächeln und Wissen über unsere List, ihn erziehen zu können, indem wir sagen, wie, wann und mit was wo gespielt wird. Dies gilt auch, wenn er schon älter ist. Wird er übermütig und allzu frech, so stellen wir ihn „kalt“ und damit ab. Mit einem unauffälligen Klaps stellen wir z. B. das In-die-Beine-Schnappen ab. Diese Technik darf konsequent jedoch nur absolut emotionslos angewendet werden, als ob wir eine Fliege von den Beinen wegscheuchen würden. Wir führen, ohne hinzusehen, die Hand dorthin, wo der Frechdachs sich erlaubt hatte zu schnappen. Nicht hinschauend und kein Wort verlierend wird seine Tat einerseits wohl korrigiert und gleichzeitig ignoriert. Übersetzt für das Hundeverständnis bedeutet dies dasselbe, wie in Beine oder Hosen zu beißen, ist unangenehm. Ganz wichtig ist die Emotionslosigkeit dabei, denn damit verbindet der Hund nichts Negatives seitens des Hundeführers, sondern etwas, das einfach passiert, wenn er in die Beine schnappt. Drehe ich mich zu ihm, packe und schüttle ich ihn, wird er sich vorsehen, und sobald ich mich ihm zudrehe, wird er sofort fliehen, ganz nach dem Motto: Fang mich doch. So geht oftmals Vertrauen verloren, das wir bis dahin mit viel Mühe und Liebe erschaffen hatten.
Warum Prägung und was wir sonst noch wissen sollten
Prägung ist die vorbereitende Lebensschulung und hat sofort bei der Übernahme des Welpen zu beginnen. Eigentlich sollte man Ferien nehmen, um ihn rund um die Uhr betreuen zu können. Diese ersten Wochen nach der Übernahme sind sehr wichtig, denn die Prägung oder besser gesagt die Erfahrungen, die der Hund in dieser Zeit macht, sind künftig verhaltensbestimmend. Hier spricht man vom Fundament des Vertrauens, das für den Hund geschaffen werden muss, einerseits und andererseits muss ihm auch sein gesamtes künftiges Umfeld sukzessive gezeigt werden, was seine Zeit braucht. Nichts ist für den Hund zu diesem Zeitpunkt wichtiger, als sich sicher und geborgen zu fühlen. So öffnet er sich dem glücklichen Lernen und seine Entwicklung schreitet harmonisch voran. In dieser Phase braucht er uns weit mehr, als wir uns dies vorstellen können. So ist er in Kürze bereit, nach dem
Kennenlernen der engsten Umgebung auch weitere Reize positiv aufzunehmen. Die ersten sechzehn Wochen im Leben des Hundes sind eben die wichtigsten! Doch achten wir in allem, was wir unternehmen: Nie zu viel auf einmal! Alle zwei Tage ein neues Erlebnis ist schon eine recht intensive Prägung, wenn wir bedenken, dass der normale Tagesablauf selbst schon enorm viel Neues beinhaltet.
Schon nach wenigen Tagen und Wochen können wir behutsam kleine Reisen in die nähere Umgebung machen. Bald folgen weitere Erfahrungen wie Tramfahrten, Busfahrten, Schifffahrten, Bahnfahrten und ein Besuch am Bahnhof mit Menschansammlungen. Mit Kindern aus der Bekanntschaft Kontakt aufnehmen, Tierparks besuchen, mit ihm auf dem Schoß uns auf eine Schaukel setzen, in einem Aufzug fahren, bei Möglichkeit einen Sessellift benutzen, den Hund über dem Nacken tragen, seinen Fang, seine Zähne kontrollieren, seinen Körper auf Zeckenbefall absuchen; all dies sind Aufgaben, die anstehen und geübt werden müssen. Wer vieles von dem befolgt, kann ihn später bei einer Verletzung problemlos transportieren, der Hund ist auf diese Weise allen Anforderungen des täglichen Lebens gewachsen. Auch differenzierte Bodenbeschaffenheiten begehen, wie Kieswege, polierte Flächen im Einkaufszentrum, Brückenstege aus Holz oder Gitterroste sind Dinge, die gelernt respektive geübt werden müssen, um später einen Hund zu haben, der problemlos solche Hindernisse zu bewältigen weiß. Der Kontakt mit Kindern ist enorm wichtig, muss aber gut geplant sein, denn dies muss kontrolliert geschehen. Kinder sollen einen positiven Eindruck hinterlassen. Wenn wir selbst nahe beim Welpen sind und die Kinder anleiten, so gewinnt dieser Vertrauen, auch wenn sie laut, etwas fuchtelnd und zögerlich sind. Das Streichelnlassen ist ebenso positiv für Kinder wie für den Welpen. So stärken wir unseren jungen Hund über die verschiedensten Erfahrungen. Aber nie den Schützling allein mit Kindern spielen lassen – ein Hund ist weder Spielzeug noch Alleinunterhalter für Kinder.
Wichtig ist auch das Kennenlernen eines Bächleins im Wald, auch können Sie ihn gerne mal über Hölzer (niedere Scheiterbeigen) locken und so den Hund lehren, sich zu überwinden – durch unsere stimmliche und freudige Motivation bestärkt. Hier ist jeder Druck oder auch nur der kleinste Zwang verboten, sondern nur Belohnung durch Lob für jeden neuen Schritt angesagt. Ebenso mit Sorgfalt über längs daliegende Baumstämme laufen lassen, indem man den Welpen darauf stellt und ihn nebenher mit viel stimmlicher Unterstützung begleitet und motiviert, um am Ende das Tier von Hand wieder auf den Boden zu stellen. Sprünge sind absolut zu vermeiden. Das Koordinieren der Sprünge über kleine Hindernisse lehrt man den Hund erst um den siebten Monat (immer Hin- und Rücksprung), nicht früher und auch nicht zu hoch (20–40 cm, je nach Größe des Hundes).
Ebenso gehört zu einer guten Prägung der Besuch von angeleiteten Spielstunden für Welpen zur Förderung der Sozialisierung. Hier können sie durch spannende Anordnungen und Hindernisse eine Fülle von Eindrücken zusammen mit anderen Hunden sammeln. Eine intensive Spielstunde in solchen Kursen ist sehr anstrengend und verlangt danach wieder entsprechende Ruhezeiten für das Hündchen.
Drehen Sie ihren Hund nie auf den Rücken oder disziplinieren Sie nie, wenn andere es befehlen. Dies wird oftmals empfohlen, darf aber selbst vom Hundeführer nicht gemacht werden. Einen Hund wehrlos zu machen ist ihm gegenüber ein großer Vertrauensentzug. Benimmt sich Ihr Hund zu aggressiv, lassen Sie ihn in einer Gruppe mit älteren Hunden mittun, oder ist dies nicht möglich, so versuche man mit den stärksten Hunden eine separate Gruppe zu schaffen. Ist dies auch nicht mehr möglich, dann suchen Sie gut sozialisierte erwachsene Hunde in der gleichen Größe, und er lernt so die Köpersprache der verschiedensten Rassen, die uns täglich begegnen. Lassen Sie mit ihrem Hund nicht einfach alles geschehen, was andere Menschen anordnen oder bestimmen. Sie selbst wissen, was Sie für Ihren Hund erträglich halten, denn Sie tragen die alleinige Verantwortung. Im Zweifelsfall ignorieren Sie einen kleineren Vorfall, denn in diesem Alter kann ja nur wenig passieren, und gerade deshalb ist es von großem Vorteil, solche Prägungsstunden zu besuchen.
Die Unterlagen, die uns zur Verfügung gestellt werden, praktische Hilfen und Unterstützung durch verschiedenste Literatur, und dies alles kostenlos, zeigen uns das reichhaltige Engagement, das uns hier zusätzlich erwartet. Diese Informationen füllen den Inhalt eines ganzen Buches und die Erkenntnis daraus hilft uns schon recht gut über die erste Zeit. Für mich persönlich ist nichts zwingender auf dieser Welt, als der Besuch einer Welpenprägung, denn erst diese gibt uns die Sicherheit für den Alltag!
Es gibt genügend Besserwisser, die Prägungsstunden als unnötig erachten und glauben, sie können und wüssten dies besser. Die vielfältigen Spiele und Erfahrungen in einer Welpen-Spielgruppe sind dermaßen prägend für unsere Hunde, dass darauf nicht verzichtet werden kann. Die Fortschritte die damit erreicht werden, auch durch das Erkennen und Erlernen der Körpersprache anderer Rassen, sowie die Erfahrungen durch Spielanordnungen, machen diese zu einem Muss! Ebenso ist dies für den Besitzer des Welpen äußerst lehrreich. Denn wo kann er über ihre Kommunikation mehr erfahren, als durch die Beobachtung einer Gruppe von Welpen. Zusätzlich erhält er in diesen Stunden noch fachkundige Erklärungen Antworten auf die verschiedensten Fragen. Selbst Hunde leiden unter diesem Sozialisierungsdefizit, der Halter ist ebenso verunsichert und dieses Versäumnis kann einfach nie, nie und nimmer nachgeholt werden! Das zeigt sich allerdings erst während der nächsten vielleicht 10–15 Jahre. Und wer muss dies immer ausbaden? Der Hund natürlich und nur der Hund!!!
Schnell wachsende Welpen der großen Rassen sollten zu Beginn nicht länger als 15 Minuten herumtollen und sich danach erst wieder erholen. Dies fünf bis sechs Mal pro Tag, um die Gelenke zu schonen und das möglichst nur auf Wiesen oder Böden, wo der Hund einen guten Halt findet. Unkontrolliertes Ausrutschen auf glatten Böden kann die Gelenkpfannen beschädigen und später zu Dysplasie führen. Füttern Sie so, dass die Rippen immer gut spürbar sind und achten Sie, dass der Hund im Junghundealter eher zu mager erscheint als zu dick. Die Gefahr von Gelenkschädigungen wird so aktiv vermindert.
Große, unbekannte Hunde nie mit Welpen spielen lassen und wenn doch, dann nur, indem der große Hund im Platzkommando liegen bleibt und der Welpe diesen so kennenlernt und beschnuppern kann. Alles andere wäre ein Risiko.
Sollte ein junger Hund Angst vor offenen oder sogenannten HolmenTreppen haben, die auch aus Stein, Holz oder durchscheinenden Gitterrosten aus Eisen sein können und sich davor ängstlich hinlegen, so ist es sinnvoll, diese Übung später, sobald er älter ist, Im Dunkeln oder auch bei nur ganz schwacher Beleuchtung durchzuführen. Der junge Hund wird Ihnen folgen, denn im Dunkeln bleibt er ungern zurück und wird sich überwinden. Dann versuchen Sie es bei Tageslicht und – oh Wunder! – er hat‘s gelernt. Die Behutsamkeit, mit der man mit dem Hund umgeht, ist das Allerwichtigste. Vertrauen gegen Vertrauen also, das ist es, was es ausmacht.
Täglich sollte man den Hund einmal komplett abtasten um einen Parasitenbefall rechtzeitig zu erkennen. Daneben sollte die Fellpflege, die Zahnkontrolle, das Aufheben und einige Meter Tragen sowie das Streicheln selbstverständlich sein. So entwickelt sich auch gegenseitiges Vertrauen und macht den Tierarztbesuch (Impfungen!) zum freudigen Erlebnis.
Wenn der Welpe bei Autofahrten fiept, bellt oder sehr unruhig ist (sofern vor der Wegfahrt ordentlich versäubert), so lassen Sie ihn, reagieren Sie nie darauf, und nehmen Sie ihn erst aus der Box, wenn er ruhig ist. Man sollte mit dem Hund während der Fahrt nicht kommunizieren. Wir fahren behutsam und lassen den kleinen Wicht möglichst still liegen. So lernt er, sich im Auto ruhig zu verhalten, und das ist diese kleine Überwindung zu Beginn wert. Mit der Zeit wird er uns bei längeren Autofahrten durch das Winseln oder Laut geben oder durch intensives Scharren seine Notdurft anzeigen. So erziehen wir für den praktischen Alltag.
Je mehr Herzblut wir in den Hund investieren, umso freudiger und motivierter wird er sich zeigen. Ist dies nicht ein schöner Lohn?
Vor Jahrtausenden hat sich der Wolf allmählich der menschlichen Umgebung angepasst und wurde sogar vereinzelt zu dessen Begleiter. Das weniger angepasste Wolfsrudel warnte unsere Vorfahren vor Feinden und bekam dafür Essensreste. So folgten sie den Menschen. Aber nur wenige konnten sich den Menschen ganz anpassen und anschließen, und diese besonderen Wölfe sind zu den Urmüttern unserer Hunde geworden. So wäre es sinnlos, Kreuzungen mit Wölfen zu versuchen in der Absicht, bessere Resultate in Sachen Gesundheit zu erzielen. Vater Wolf, Mutter Haushund; also Hybriden-Welpen sind äußerst schwierig zu halten. In praktisch allen Fällen wurden diese Hybriden nach spätestens drei Jahren unkontrollierbar aggressiv und äußerst gefährlich für deren Besitzer, weil in der Genetik die angeborene Angst durch das frühere Bejagen der Wölfe durch den Menschen manifest wird, sofern keine Rückzugsmöglichkeit für den Hybriden bestand. So griffen diese Tiere oftmals die Menschen unverhofft an und verletzten sie. Eine Studie in den USA verfolgte eine Vielzahl dieser Spezies, und nach nur drei Jahren kamen keine Antworten mehr über deren Entwicklung respektive das Überleben dieser Tiere. Unser Hund stammt wohl zu über 98% genetisch vom Wolf ab, kann sich noch mit dem Wolf paaren, doch seine soziale Entwicklung ist nicht dieselbe. Das Hirn des Haushundes ist kleiner als das des Wolfes und ist somit etwas anders, vielleicht angepasster und einfacher gestrickt, gemacht für das Zusammenleben mit Menschen.
Gute Zuchten erzielen temperamentvolle Hunde gepaart mit Sicherheit (stabiles Nervenkostüm). Dies ist eine gute Voraussetzung für den Hundesport. Aus den vielen ehemaligen Ur-Hunden und Bastarden entstanden durch gekonnte Zucht stabile Rassen, von der jede nach ihrer Veranlagung etwas Besonderes ist. Aufgrund von verschiedenen Vorstellungen über deren Einsatzmöglichkeiten sowie Vorlieben in Aussehen und verschiedenen Fähigkeiten wurden die heutigen Variationen gezüchtet und gefördert, was aus den sehr differenzierten Rassen deutlich hervorgeht. Nur der Spitzensport arbeitet mit Hunden, für die es mehr Kenntnis und Erfahrung im Umgang braucht, denn diese verfügen zumeist über mehr Trieb als andere. So entwickelten sich auch entsprechende Zuchtlinien für Gebrauchshunde.
Züchten heißt nicht vermehren, sondern züchten heißt im Grunde die Wesensmerkmale wie Lernfähigkeit, Aussehen, Gesundheit und Fähigkeiten (Eignungen durch Selektion) einer Rasse durch Optimierung zu stabilisieren. Daher ist die Information über das Wesensgefüge der Zuchthündin wichtig, denn auch dies ist ein wichtiger Mitprägungsfaktor bei unserem Welpen.
Ob Familien-, Sport- oder Polizeihund, grundsätzlich ist die Entwicklung vom Welpen zum jungen Hund immer gleich. Man kann bereits ab dem dritten bis vierten Monat mit spielerischem Fährtenlesen beginnen, was für den Hund sicher eine Freude sein wird, wollen wir in Richtung Sport- oder Diensthund gehen. Eine Würstchenfährte kann zu Beginn zehn Meter betragen. Vielleicht können Sie am Ende sein Futter hinstellen. Sukzessive kann diese Fährte verlängert werden, doch ist eine gründliche Instruktion eines guten Übungsleiters hier von großem Nutzen. Man kann den Hund ebenso veranlassen, ohne Leine zu suchen, dabei aber keinesfalls eingreifen, sondern beobachten, mit Liebe führen und geschehen lassen, denn es ist ja nur ein Spiel! Er lernt, den Wurstgeschmack mit dem Geruch der Bodenverletzung zu verbinden, um später nur noch der reinen Bodenverletzung zu folgen. Man kann auch einen rechteckigen oder runden Fleck austreten. Hier verstreut man dann Futter, außerhalb gibt es nichts. Auch so lernt der Hund die Verknüpfung von Bodenverletzung und Futter kennen. Bis zum siebten Monat ist das gute, abwechslungsreiche Spiel mit dem Hund die beste Voraussetzung für eine positive Entwicklung.
Gute Kurse für junge Hunde zeigen uns weitere Möglichkeiten für zielgerichtete Spiele auf, die die Team-Bindung stärken. Vielseitigkeit vergrößert die Intelligenz des Hundes und fördert gleichzeitig die Aufmerksamkeit. Schauen Sie ihm in die Augen, spielen Sie aufmerksam mit ihm, der Hund wird’s später lohnen durch das gegenseitig gelernte kommunikative Verhalten. Es gibt heute viel zu viele Hundeführer, die wirkliches Spielen mit dem Hund weder verstehen, noch zu nutzen in der Lage sind.
Konsequenz ist die Voraussetzung für jeglichen Gehorsam. Achten wir zum Wohle unsere Hunde auch darauf, dass auf den Übungsplätzen alles, was mit Gewalt und Härte zu tun hat, für unseren Vierbeiner ausgeschlossen wird. Für unseren Hund sind nur wir persönlich verantwortlich. Es gibt Ausbilder, die schnell zum Zwang greifen. Bleiben Sie stark und verlassen Sie sich auf den Rat, dass nur positive Motivation mit dem jungen Hund zum Ziel führt und niemals verfrühter Druck. Es kommt später immer darauf an, wann und wie Druck ausgeübt wird. Je höher der Hund im Trieb, das heißt, je motivierter er ist, mit uns zu arbeiten, umso mehr können wir ihn belasten. Die Bindung wächst beim Hund so immer mit. Als Welpe ist er sehr sensibel, doch mit der Zeit, so nach etwa sechs bis acht Monaten ist die Bindung schon soweit gefestigt, dass er bereits einen gewissen Grad an größerer Belastung problemlos wegsteckt. Man sieht es sehr oft, dass Hunde, die zu früh einem übermäßigen Druck ausgesetzt wurden, diesen nur eine kurze Zeit durchstehen, und dann oftmals Ersatzhandlungen zu zeigen beginnen (Ersatzhandlung ist ein Ausweichen von Druck). So lohnt es sich, dem Hund Zeit zu geben, erwachsen zu werden. Auch zu fantasievolles und stressiges Spiel kann zu ähnlichem Verhalten führen und den Hund zu unschönem Übermut verleiten. Es wird später schwierig, in gelassene Abläufe überzugehen und kann ebenso zu Bindungsverlust führen, wenn wir allzu drakonisch das Spiel unterbrechen, respektive in vernünftige Bahnen zwingen wollen oder müssen. Aber man bedenke: Hat der Hund einen gegebenen Befehl verstanden, muss er auch ausgeführt werden. Kann er dies nicht, gehen Sie einen Schritt zurück, überlegen Sie, was nicht richtig verstanden worden sein könnte, und beginnen Sie neu.
Lassen Sie den Hund möglichst mit anderen Hunden herumtollen, nachdem Sie die kleinen Übungen des Alltages, ähnlich wie „Frühturnen“, absolviert haben, oder lassen Sie ihn nur dann spielen, wenn Sie danach nicht unmittelbar auf den Übungsplatz gehen. Jeder Hund bindet sich viel leichter an Artgenossen als an uns, und aus diesem Grunde ist in allem das richtige Maß wichtig. Wer am Abend auf den Hundesportplatz will, sollte nicht zu große Wanderungen gleichentags machen oder den Hund mit anderen Vierbeinern allzu lange spielen lassen. Dies beeinträchtigt seine Aufmerksamkeit, die Ausprägung ist aber bei jedem Hund unterschiedlich. In unserem zielgerichteten Spiel sollte die Post abgehen! Einen müden Hund lockt selbst der Hundeführer nicht aus seiner Reserve, und wir sind ja ein Team. Ist der Hundeführer nervös, deprimiert oder voller Unlust, sollte er seinen Hund einfach Hund sein lassen und auch mal nichts tun.
Ebenso wichtig ist, vor jedem Üben dem Hund genügend Zeit zu geben, sich zu versäubern. Er wird dann konzentrierter mittun. Nie auf dem Übungsplatz versäubern lassen! Ebenso sollte man den Hund unmittelbar zuvor nicht füttern. So können wir durch sein Fordern nach Futter uns mit größerer Nachhaltigkeit durchsetzen. Wer arbeitet schon gerne mit vollem Bauch. Nach einer Mahlzeit sollte dem Hund immer Zeit gegeben werden zu ruhen. Das Spielen mit vollem Magen ist gerade für sehr junge Hunde nicht ideal, ist dies doch eine relativ große Belastung im Verhältnis zu seinem jungen und schnell wachsenden Körper. Oft schlafen Welpen zu Beginn gerne nach dem Fressen.
Wollen wir die Schussgleichgültigkeit bei unseren Hunden überprüfen, darf nie geschossen werden, wenn Hunde angebunden sind oder herumliegen, sondern nur während diese spielen respektive wir sie in ein interessantes Spiel verwickelt haben. So verknüpft der Hund den Knall mit Spiel und das Geräusch verliert damit die beängstigende Komponente. Ist die Mutterhündin nicht schussgleichgültig, so werden es auch die Welpen nicht sein. Dies ist auch beim Kauf des Hundes zu beachten!
Wichtig sind auch kleine Konzentrationsübungen. Versuchen Sie, den Hund neben sich zu setzen, halten sie ein Wurststückchen zwischen den Lippen, damit er aufschaut, und bestätigen Sie das Aufschauen durch das Belohnen mit demselben. Verzögern Sie die Futtergabe und verlängern Sie damit das konzentrierte Aufschauen. Dies sind kleine spielerische Übungen, die aber später enorm gute Dienste leisten. Täglich ein paar Mal ein „Sitz, Platz und Steh“ üben, das kann man in wenigen Minuten machen. Den Lohn für den Hund nie vergessen, denn auch er arbeitet wie wir nur gegen Entgelt!
Bei Wesensprüfungen oder sonstigen Prüfungen wird der grundsätzliche Charakter überprüft. Das Wesen eines Hundes setzt sich zusammen aus Erbgut und Prägung. Je besser und reicher wir damit unseren Hund ausstatten, je rücksichtsvoller und verständnisvoller wir mit ihm als Welpe und in den ersten Lebensmonaten umgehen, umso mehr werden wir durch seine innere Sicherheit profitieren. Ein Hund, der liebevoll aufgezogen wird, lernt, der Umgebung zu vertrauen, und fühlt sich in allen Situationen wohl.
Instinkte sind angeborene Mechanismen, die im Hund durch Vererbung verankert sind. Dieses spezifische Verhalten erklärt sie zum Hund und entspricht dem arttypischen Verhalten wie das Schnuppern und Beschnuppern von Markierungen und das „Lesen“ derselben. Das sind alles Grundreaktionen, die das Tier zum Überleben braucht. Daher sollten wir den Hund hin und wieder ausgiebig seine Umgebung beschnuppern lassen. Wir müssen ihm dafür Zeit einräumen, auch um seine Merkfähigkeit für die unendlichen Unterschiede der Gerüche zu fördern und diese kennenzulernen.
Das Triebverhalten zeigt sich durch entsprechendes Engagement bei der Arbeit und dient ebenso der Arterhaltung. Die differenzierten Veranlagungen der Hunde ergeben schlussendlich zusammen die rassespezifischen Wesenseigenschaften, welche in den diversen Zuchten gefördert und verstärkt werden.
Unter Jagd- und Beutetrieb verstehen wir das Suchen und Aufspüren des Wildes respektive das Jagen und Fassen der Beute. Der Hetztrieb ist mit dem vorherigen eng verwandt und wird auf der Jagd eingesetzt. Stöbertrieb ist das Aufbringen von Wild auf einer unübersichtlichen Weide. Es gibt Sichtjäger, andere Rassen haben wiederum eine ausgesprochene Veranlagung, hauptsächlich mit ihrer Nase zu suchen. So können auch diese Unterschiede unseren Entscheid bei der Auswahl unseres Hundes beeinflussen.
Ebenso natürlich wie wichtig ist der Spieltrieb, der später in einen Betätigungstrieb wechselt und ganz speziell der Motivation beim Hundesport gute Dienste leistet. Ein Fluchttrieb ist nur akzeptabel beim Welpen und entspricht eher der Vorsicht respektive seinem Selbstschutz, sollte sich dann aber während der Prägungsphase, d. h. innerhalb 3–4 Monaten verlieren. Sollte Ängstlichkeit weiter vorherrschen, könnte der Hund möglicherweise ein traumatisches Erlebnis gehabt haben. Ausgeprägte Scheu, Misstrauen und Furcht sind jedoch denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Ausbildung und die Sozialisierung. Deshalb ist ja auch die Verantwortung des Züchters gerade in dieser Beziehung besonders groß, und wir sollten ihm vertrauen können und möglichst seine Gewissenhaftigkeit diesbezüglich kennen.
Weitere Triebe wie Geschlechtstrieb, Pflegetrieb, Kampftrieb, Schutztrieb, Wacht- und Wehrtrieb sind Triebe, die wir in der Ausbildung als Hilfen einsetzen respektive mehr oder weniger fördern oder zu kanalisieren haben.
Die Nutzbarmachung dieser Triebe im Umgang mit unseren Hunden ist etwas vom Faszinierendsten. Andererseits bewirkt ein verständnisloses Unterdrücken ein seelisches Verkümmern. So bedenken wir, bevor wir etwas korrigieren, was wir mit einer unterdrückenden Maßnahme bewirken oder anrichten. Psychische Störungen sind oft die Folge, und es wäre besser gewesen, anstelle einer Unterdrückung, die Aggression auslösen kann, eine Umleitung in eine andere Triebhandlung zu vollziehen. So nutzen die Hundesportler den Schutzdienst als Kompensation der natürlichen Triebanlage auf Beute. Dies heißt, den Hund artgerecht so zu halten, dass er seine Triebe ausleben kann, indem Beutespiele durch Schutzdiensthelfer diesen Trieb eindeutig während des Sports kanalisieren. Hiermit ist gewährleistet, dass der Hund im täglichen Umgang ausgeglichen und für niemanden gefährlich wird.
Nach einiger Zeit können die Spielchen von der Wohnung auf die nahe Wiese verlegt werden, doch eines muss ich immer wieder betonen: Nie so viel tun, dass es dem Welpen zu viel wird. Welpen sind nichts für kleine Kinder! Schlechte Erfahrungen mit Kindern während der ersten Lebensmonate können später unerwünschte Reaktionen auslösen, wobei der Hund später aus Angst vor dem Erlebten plötzlich glaubt, sich selbst schützen zu müssen und unverhofft mit einem Verteidigungsangriff reagiert! Daher sollten Kinder nur im Beisein von Erwachsenen mit Hunden behutsam spielen dürfen.
Solange die ersten Zähne noch gut verankert sind, ist ein dickes Seil zum „Kämpfen“ ebenso ein idealer Gegenstand wie ein Stück Leder oder ein dickes Tuch. Alles muss dosiert sein, sodass keine Schmerzen bei den Zähnen des Hundes auftreten. Der Sinn liegt darin: Der Welpe darf und soll gewinnen! Schmerzen durch Entreißen dürfen nie entstehen, denn so könnte er das Zufassen mit Schmerz verbinden, und das Apportieren wäre künftig nur mit großer Überwindung und Schwierigkeiten noch erlernbar. Der Hund soll zwischendurch sich auch selbst beschäftigen können, und so sind Kauknochen ebenso geeignet wie hin und wieder ein Ast oder ein altes Stück verknüpftes Seil oder ein alter Lappen, den er totschütteln und zerreißen darf.
Während des Zahnwechsels ist größte Vorsicht geboten, was Beutespiele, vor allem das gegenseitige Ziehen, anbetrifft. Andere Spiele sind dafür umso mehr gefragt wie „Bring den Ball“. Ansonsten sollte etwas zum Kauen überlassen werden oder man lässt ein dickes Seil fangen, indem man es wie eine Schlange über den Boden schwenkt. Kann er es fassen, dann lassen wir sogleich los, und sobald er wieder loslässt, bewegen wir die „Schlange“ erneut.
Spätestens nach dem Zahnwechsel sollten wir erfahren haben, wie motivierbar unser junger Hund ist. Wichtig ist auch zu wissen, was ihn fesselt, und so wird auch das Spiel immer lebendiger, der Hund größer und schneller sowie gewitzter und frecher. Seine Entwicklung ist bereits so weit fortgeschritten, dass wir jetzt auch zwischendurch Befehle wie „Sitz“ in das Spiel einbauen können, um gleich danach weiterzuspielen, was einer positiven Bestätigung und ebensolchem Lob gleichkommt. Immer daran denken, nichts übertreiben und das Spiel aufhören, wenn es am schönsten ist. Nur so erhalten wir die Freude und Spannung sowie die mit der Zeit bewusste Aufforderung vom Hund, das Spiel erneut zu beginnen, was wir am kommenden Tag gerne wieder tun, um später auch am neuen Tag der Spielaufforderung erst nachzukommen, wenn wir Lust verspüren. So lernen wir den Hund fordern und fördern ihn auch in der Entwicklung seiner Intelligenz. Man bedenke, dass die freudige Stimme das wichtigste Instrumentarium ist, und solange die Freude nicht übermittelt werden kann, versinken wir in Monotonie und werden für den Hund langweilig.
Mit dem Motivationsgegenstand Ball, Kong oder Boudin (Beißwurst) an einer Schnur/Halteschlaufe in der rechten Hand und in einem Kreis von sechs bis acht Metern Durchmesser laufend, folgt uns der Hund auf der linken Seite. Geht er auf der Höhe des linken Knies einige Meter korrekt, so belohnen wir ihn über Futtergabe oder im Spiel mit dem Gegenstand. Dies nie länger als zwei bis drei Minuten am Stück üben. Mit viel stimmlicher Unterstützung und Lob zeigen wir ihm unsere Freude. Sollte der Hund den Motivationsgegenstand nicht mehr hergeben wollen, dann versuchen wir einen Tausch mit einem Stückchen Wurst oder Ähnlichem. Auf keinen Fall entreißen wir ihm seine Eroberung, ohne etwas Entsprechendes dafür anzubieten. Kein Hund reagiert auf alles gleich, und daher sind wir gefordert, durch gutes Beobachten gedanklich auf den eigenen Hund einzugehen. Wird ein Hund auf einen Gegenstand allzu gierig und fordert diesen bis zu einer gewissen Aggressionsbereitschaft, ist zu empfehlen, diesen Gegenstand eine gewisse Zeit wegzulassen und weiterhin mit Futtergabe zu bestätigen und zu belohnen. Futter hat eine beruhigende Wirkung. Man sollte den jungen Hund nicht zu früh zum Kämpfen ermuntern. Im Triebverhalten zu bestätigen ist sehr einfach, doch den Hund wieder in die Normalität zurückzuführen weitaus schwieriger.
Spiel ist das Benzin für den Motor des Hundes. Er hat noch kein Durchstehvermögen und lernt dies durch Übung. Ein Spiel ist auch Dressur, und wer glaubt, ein junger Hund lerne mit Gewalt und Zwang, irrt. Es ist richtig, Dressur ist ein tägliches Spiel mit Abläufen zu bestimmten Zielen, doch das Tun muss aus dem Herzen, dem Verstand und der inneren Freude stammen. Dies wirkt motivierend für Hund und Führer. Es gehören Fantasie und Selbstdisziplin dazu, schlechte Laune ist Gift für das Team, es sei denn, unser Hund motiviert uns durch seine „Spiel mit mir Aufforderung“. Das gibt es! Was für tolle Momente! Hier flieht die schlechte Laune echt, und so gibt es Hunde, die für ihre Besitzer echte Therapeuten sind. Das vielfältige, engagierte Spiel auch mit gleichaltrigen Artgenossen respektive mit anderen Welpen liegt nun bereits hinter uns. Weitere interessante Möglichkeiten, den Hund zu beschäftigen, ergeben sich im Wald (Frühjahr bis Herbst Zeckenschutz nicht vergessen), beim Versteck-Spielen und auf Ausflügen in die Umgebung, z. B. am See mit Planschen am Ufer, Suchspiele und vieles andere mehr.
Jede Arbeit führt über ein Triebziel (Triebziel gleich Futter oder Spiel mit Belohnungsziel Ball) wie das bei „Fuß“ laufen: Sobald der Hund links von mir geht (immer zu Beginn im Uhrzeigersinn im Kreis gehen), kann ich mit Futter oder Spiel sein korrektes Verhalten bestätigen. So lernt er über das Triebziel mit der Zeit vom Führer mit diesem Verhalten Bestätigung zu fordern. Alles aber nur zwei bis drei Mal kurz pro Tag.