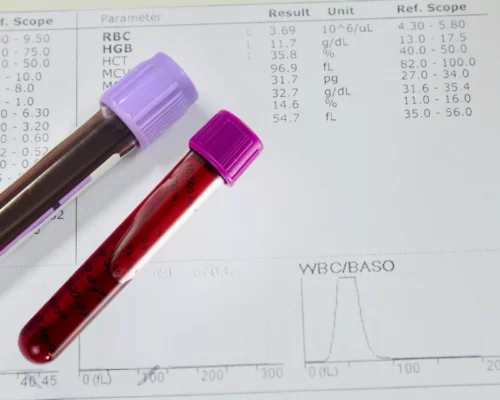Die Hundesteuer – für die einen Hundebesitzer eine gerechte Abgabe, für die anderen eine willkürliche Belastung. Doch warum gibt es sie überhaupt? Wieso kostet sie in manchen Gemeinden kaum etwas und anderswo ein kleines Vermögen? Und fliesst das Geld wirklich in hundefreundliche Projekte oder doch ganz woanders hin?
Seit wann gibt es die Hundesteuer?
Die Hundesteuer hat eine lange Tradition. Bereits im 19. Jahrhundert wurde sie in vielen europäischen Ländern eingeführt – in Deutschland beispielsweise 1807 im Herzogtum Gotha. Die Idee dahinter: Hundehalter sollten für die Haltung ihrer Tiere zahlen, um die Verbreitung von Streunerhunden einzudämmen und potenzielle Gefahren wie Tollwut zu reduzieren.
In Österreich gibt es die Hundesteuer seit dem 19. Jahrhundert, allerdings ist sie Ländersache und wird von den einzelnen Bundesländern geregelt. Auch in der Schweiz ist die Hundesteuer historisch verwurzelt, wurde aber in manchen Kantonen mittlerweile abgeschafft oder durch andere Abgaben ersetzt.
Wozu dient die Hundesteuer?
Historisch gesehen wurde die Hundesteuer eingeführt, um die Anzahl der Hunde zu regulieren und staatliche Einnahmen zu generieren. Heute wird sie oft als eine Art „Luxussteuer“ betrachtet, doch die tatsächliche Verwendung variiert je nach Land und Gemeinde erheblich.
Heutzutage wird die Steuer oft als nicht zweckgebundene Einnahmequelle für die Gemeinden genutzt. Das bedeutet: Die Einnahmen müssen nicht zwingend für Hunde oder Tierschutz verwendet werden. Stattdessen fliessen sie in den allgemeinen Gemeindehaushalt und finanzieren beispielsweise Schulen, Strassen oder Verwaltungsaufgaben.
- Deutschland: In den meisten Gemeinden wird die Hundesteuer als allgemeine Einnahme verbucht. Sie dient offiziell der „Lenkung der Hundehaltung“, also als eine Art Regulierungsinstrument, um die Anzahl der Hunde zu begrenzen.
- Österreich: Hier wird sie ähnlich gehandhabt, allerdings gibt es regionale Unterschiede. In Wien gibt es beispielsweise eine zweckgebundene „Wiener Hundeabgabe“, die teilweise in die Ausbildung von Assistenzhunden fliesst.
- Schweiz: Die Hundesteuer existiert je nach Kanton und Gemeinde in unterschiedlicher Form. Manche Kantone haben sie abgeschafft, während andere sie noch erheben. Einige Gemeinden zweigen einen Teil der Einnahmen für Hundewiesen oder Kotbeutelspender ab, aber das ist nicht die Regel.
Zusammenfassung: Die Hundesteuer existiert aus historischen Gründen, wird aber heute vor allem als Einnahmequelle genutzt. Eine direkte Verwendung für hundebezogene Zwecke ist in den meisten Fällen nicht vorgeschrieben – was oft als ungerecht empfunden wird.
Warum gibt es bei der Steuer in verschiedenen Gemeinden so extreme Unterschiede?
Die Hundesteuer ist eine der uneinheitlichsten Abgaben überhaupt. Sie hängt nicht nur von der Region, sondern auch von politischen und wirtschaftlichen Faktoren ab. Während manche Gemeinden Hundefreunde entlasten, nutzen andere die Steuer gezielt als zusätzliche Einnahmequelle oder sogar als Massnahme zur Abschreckung bestimmter Hunderassen.
Wer mit seinem Hund umzieht, kann eine böse Überraschung erleben: Während man in einer Gemeinde vielleicht nur 50 € Hundesteuer zahlt, können es anderswo 200 € oder sogar mehr sein. Das hat folgende Gründe:
- Die Hundesteuer ist eine kommunale Abgabe: Die Hundesteuer wird nicht bundesweit einheitlich festgelegt, sondern jede Gemeinde entscheidet selbst, ob und wie viel sie verlangt. In Deutschland und Österreich können die Unterschiede deshalb selbst innerhalb eines Bundeslands riesig sein. In der Schweiz regeln die Kantone die Hundesteuer, trotzdem dürfen Gemeinden eigene “Tarife” festlegen.
- Einflussfaktoren der Region: In Grossstädten ist die Steuer oft viel höher als auf dem Land. Das liegt weniger an tatsächlichen Ausgaben für Hundeinfrastruktur, sondern vielmehr daran, dass Städte generell höhere Steuersätze festlegen. Zudem gibt es in urbanen Gebieten oft mehr Hundehalter, sodass die Steuer dort eine lukrative Einnahmequelle für die Gemeinde darstellt.
- Finanzielle Lage der Gemeinde: Manche Gemeinden nutzen die Hundesteuer als Einnahmequelle, um ihr Budget aufzubessern. Gerade finanziell schwache Kommunen verlangen deshalb oft höhere Steuersätze.
- Politische Entscheidung: Es gibt Gemeinden, die bewusst niedrige oder gar keine Hundesteuer erheben, um hundefreundlich zu sein. Andere setzen hohe Steuern, um die Hundehaltung eher unattraktiv zu machen.
- In vielen Städten gibt es erhöhte Steuersätze für Listenhunde. Diese können mehrere Hundert Euro pro Jahr betragen – angeblich als Massnahme zur Sicherheit, oft aber eher als Abschreckung.
Warum wird die Hundesteuer nicht zur Unterstützung von Tierheimen genutzt?
Viele Hundebesitzer gehen davon aus, dass die Hundesteuer zumindest teilweise Tierheimen oder anderen tierschutzrelevanten Einrichtungen zugutekommt. Schliesslich wäre es naheliegend, dass eine Abgabe auf Hunde auch für das Wohl von Hunden eingesetzt wird. Doch in den meisten Fällen ist das nicht so – und das sorgt immer wieder für Diskussionen.
Der Hauptgrund, warum Tierheime nicht direkt von der Hundesteuer profitieren, liegt in der fehlenden Zweckbindung der Einnahmen. Die Hundesteuer ist eine kommunale Abgabe, die in den allgemeinen Haushalt der jeweiligen Stadt oder Gemeinde fliesst. Das bedeutet, dass sie für sämtliche kommunalen Ausgaben genutzt werden kann – etwa für den Strassenbau, Schulen, Verwaltungskosten oder andere öffentliche Projekte.
- Deutschland: Die Hundesteuer ist eine sogenannte Bagatellsteuer, was bedeutet, dass sie nicht zweckgebunden sein muss. Die Gemeinde kann selbst entscheiden, wofür sie die Einnahmen verwendet. Nur in wenigen Ausnahmen gibt es freiwillige Projekte, die mit den Geldern finanziert werden, etwa Hundewiesen oder Kotbeutelspender.
- Österreich: Auch hier handelt es sich um eine nicht zweckgebundene Abgabe. Allerdings gibt es regionale Unterschiede: In Wien fliesst ein Teil der „Wiener Hundeabgabe“ in die Ausbildung von Assistenzhunden. Eine direkte Unterstützung für Tierheime gibt es aber nicht.
- Schweiz: In einigen Schweizer Gemeinden gibt es spezielle Regelungen, bei denen ein kleiner Anteil der Hundesteuer für tierschutzbezogene Projekte verwendet wird. In den meisten Kantonen ist die Hundesteuer jedoch eine reguläre Abgabe ohne direkte Verbindung zu Tierheimen oder anderen Hundethemen.
Wie werden die Tierheime dann finanziert?
Da Tierheime keine Gelder aus der Hundesteuer erhalten, sind sie in erster Linie auf Spenden, Fördergelder und Zuschüsse angewiesen. In vielen Fällen werden sie von Tierschutzvereinen oder Stiftungen betrieben, die sich um finanzielle Unterstützung bemühen müssen.
In Deutschland erhalten manche Tierheime Zuschüsse von Städten oder Gemeinden, weil sie Fundtiere aufnehmen – das ist aber eine freiwillige Leistung der Kommunen und hat nichts mit der Hundesteuer zu tun. In Österreich und der Schweiz sieht es ähnlich aus: Tierheime bekommen in manchen Fällen staatliche Unterstützung, sind aber oft auf Spenden angewiesen.
Wäre es nicht sinnvoller, die Hundesteuer für Tierheime zu verwenden?
Diese Frage wird unter Hundebesitzern oft kontrovers diskutiert. Befürworter argumentieren, dass eine Hundesteuer nur dann gerechtfertigt ist, wenn das Geld auch für hundebezogene Zwecke verwendet wird – und dass Tierheime, die sich um ausgesetzte oder abgegebene Hunde kümmern, dringend finanzielle Unterstützung brauchen.
Gegner dieser Idee entgegnen, dass nicht jeder Hundebesitzer automatisch für die Kosten von Tierheimen aufkommen sollte, da viele Hunde gar nicht aus dem Tierschutz stammen. Zudem sei es Sache des Staates, den Tierschutz angemessen zu finanzieren, unabhängig von einer Steuer auf Hundehaltung.
Warum gibt es eine Steuer für Hunde, aber nicht für Katzen?
Die Antwort auf diese Frage liegt in der historischen Entwicklung, dem Verhalten der Tiere und politischen Entscheidungen.
Die Steuer für Hunde wurde im 19. Jahrhundert eingeführt, um die Zahl der Hunde zu regulieren, da freilaufende Hunde und somit auch Tollwut ein grosses Problem waren. Während Katzen eher als freilebende Nützlinge (zur Fernhaltung von Mäusen und Ratten) galten, wurden Hunde eher als Besitz ihrer Halter betrachtet.
Ein weiterer Grund für die Steuer auf Hunde ist die theoretische Belastung für die Allgemeinheit. Hundehalter nutzen mit ihren Tieren öffentliche Flächen, und Gemeinden müssen für Dinge wie Kotbeutelspender und Entsorgung, Hundewiesen bzw. Freilaufflächen sowie Massnahmen gegen Lärmbelästigung durch Hundegebell aufkommen. Katzen werden in dieser Hinsicht allgemein als unauffälliger angesehen: Sie verscharren ihren Kot und bewegen sich eher unbemerkt in der Umgebung.
Darüber hinaus gibt es weitere Gründe, die die Einführung einer Katzensteuer erschweren:
- Während Hunde vielerorts gechippt und registriert sein müssen, gibt es für Katzen oft keine gleichwertige Meldepflicht. Eine Steuer wäre deshalb schwerer durchzusetzen.
- Da Katzen seltener kommunale Ressourcen “in Anspruch nehmen”, gibt es aus Sicht vieler Gemeinden keinen Grund, sie zu besteuern.
- Die Hundesteuer ist historisch gewachsen und hat sich als kommunale Einnahmequelle etabliert. Katzen wurden hingegen nie als steuerpflichtige Haustiere betrachtet.
Ob das gerecht ist, bleibt Ansichtssache – aber die Einführung einer Katzensteuer bleibt unwahrscheinlich.
Warum sind Assistenzhunde steuerbefreit?
In vielen Ländern sind Assistenzhunde von der Hundesteuer befreit oder es gibt zumindest Ermässigungen. Als Assistenzhunde gelten speziell ausgebildete Hunde, die Menschen mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen im Alltag unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Blindenführhunde, Signalhunde (für Gehörlose), Mobilitätsassistenzhunde, PTBS-Assistenzhunde oder Diabetes– bzw. Epilepsie-Warnhunde.
In Deutschland und Österreich etwa gilt die Hundesteuer als sogenannte “Aufwandsteuer” und wird erhoben, weil Hunde als Luxusgut gelten. Da Assistenzhunde jedoch medizinisch notwendig sind und keine freiwillige Anschaffung aus Genussgründen darstellen, sind sie steuerbefreit. Die meisten Kantone in der Schweiz befreien Assistenzhunde ebenfalls vollständig von der Steuer, da sie als medizinisches Hilfsmittel eingestuft werden – ähnlich wie ein Rollstuhl oder eine Gehhilfe.
Kann ich die Hundesteuer umgehen, indem ich meinen Hund zum Assistenzhund ausbilden lasse?
Eine Steuerbefreiung gilt nur unter bestimmten Bedingungen – nicht jeder ausgebildete Hund ist automatisch steuerfrei. Die genauen Regelungen sind je nach Land und Gemeinde unterschiedlich, aber meistens sind mehrere spezifische Nachweise nötig, um sich von der Hundesteuer befreien zu lassen:
- Eine ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass der Hund als Assistenzhund benötigt wird
- Ein Nachweis über eine anerkannte Ausbildung als Assistenzhund (z. B. Zertifikate von spezialisierten Hundeschulen)
- Teilweise wiederkehrende Bestätigung (z.B. jährlich), dass der Hund weiterhin als Assistenzhund tätig ist
Darüber hinaus sind die Anforderungen an einen Assistenzhund hoch, und die Ausbildung ist teuer (oft über 25.000 €). Es wird genau geprüft, ob wirklich ein medizinischer Bedarf besteht. Wer seinen Hund nur als „Assistenzhund“ anmeldet, um die Steuer zu umgehen, riskiert eine Ablehnung oder sogar rechtliche Konsequenzen.
Fazit: Hat die Hundesteuer heute überhaupt noch eine Daseinsberechtigung?
Die Hundesteuer wurde ursprünglich eingeführt, um die Ausbreitung von Tollwut einzudämmen und die Zahl der Hunde zu regulieren. Doch diese Gründe sind eigentlich längst überholt: Tollwut ist in vielen europäischen Ländern ausgerottet und es gibt strenge Impf- sowie Einreisebestimmungen für Hunde. Auch Kennzeichnungspflichten bestehen bereits in vielen Regionen, unabhängig einer Hundesteuer. Davon abgesehen fliesst die Steuer bei den meisten Gemeinden in den allgemeinen Haushalt, statt gezielt die Hundehaltung zu fördern.
Dennoch bleibt die Hundesteuer bestehen – aus “Tradition” und als leichte Einnahmequelle für Kommunen. Während einige Länder (wie die Niederlande) bereits darauf verzichten, halten andere an ihr fest – oft ohne klare Begründung.
Eine moderne Alternative könnte unserer Meinung nach eine zweckgebundene Abgabe sein, die tatsächlich für Hundeinfrastruktur oder Tierschutzprojekte verwendet wird.
Bis dahin bleibt die Hundesteuer ein umstrittenes und oft wenig nachvollziehbares Relikt vergangener Zeiten.